

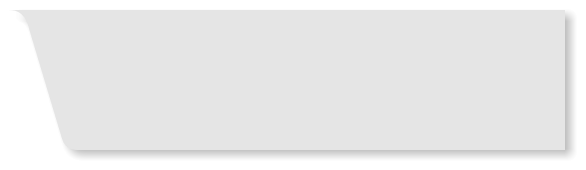
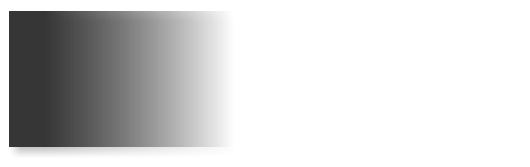
Siegfried
Trapp
Willkommen
Bienvenido
Welcome




Debatte Wirtschaft und Wachstum:
Der grüne Osterhase
Es gibt keine Entkopplung von Wachstum und planetarischer Zerstörung, weshalb es auch keine
politische Umsteuerung geben kann. Aber es gibt Rettungsboote.
Ökonomische Transformation: Grünes Wachstum oder Degrowth? Foto: Archiv
Von NIKO PAECH
In einem Beitrag in der vorhergehenden Ausgabe von taz FUTURZWEI (Nr. 23)
referiert der Politologe Martin Unfried aktuelle Vorschläge zur klimagerechten
Transformation moderner Ökonomien. Beginnend mit der Position des grünen
Wachstums legt er deren Vertretern nahe, sie mögen »die Schwachstellen des
eigenen Ansatzes offen benennen und mögliche Lösungen diskutieren«. Zu Recht
verweist er dabei auf die misslingende Entkopplung wachsenden Wohlstandes von
Umweltschäden. Aber insoweit grünes Wachstum in nichts anderem besteht als
eben darin, steigende Güterproduktion ökologisch zu entkoppeln, strandet diese
Empfehlung in einem Zirkelschluss. Denn ebenso ließe sich dann die Nichtexistenz
des Osterhasen als dessen Schwachstelle identifizieren, für die Lösungen zu
suchen wären. Das Problem des grünen Wachstums liegt also eher in der
Fortschrittsgläubigkeit jener, die an dieser allen Naturgesetzen widersprechenden
Absurdität weiter festhalten.
Sodann werden einige wachstumskritische Veröffentlichungen ins Visier
genommen. Ihnen fehle es an konkreten Umsetzungsperspektiven, insbesondere
einer »ausgearbeiteten Makroökonomie«, um ein »stabiles Nicht-Wachsen«
steuern zu können. Offensichtlich übersieht Martin Unfried, dass längst
makroökonomische Modelle vorliegen, die eine Degrowth-Strategie als stabilen
Entwicklungspfad darstellen. Das Problem bestand nie darin, Postwachstums-
szenarien herauszuarbeiten, die sich in politische Maßnahmen überführen lassen,
sondern in den unvermeidbaren Folgen für den vorherrschenden Lebensstil. Denn
auch mit einer ausgeklügelten Makroökonomik lässt sich weder die Physik noch die
Wählermehrheit überlisten. Ohne die Letztere ist eine zentral koordinierte
Degrowth-Strategie aber nicht demokratisch zu rechtfertigen. Wenn kein
technologisches Entkopplungswunder zu erwarten ist, folgt daraus neben der
Notwendigkeit einer Postwachstumsökonomie eine zweite, nicht minder
einschneidende Konsequenz: Demokratische Regierungen verlieren im
Nachhaltigkeitsbereich die Basis ihrer bisherigen Handlungsfähigkeit.
Die Imagination einer vernunftgeleiteten Wählermehrheit, die sich rechtzeitig
herausbildet, um für das politisch Notwendige zu votieren, stützt sich auf die
verführerische Annahme, dass Umweltprobleme durch kollektive Entscheidungen
komfortabel und effizient gelöst werden können, nämlich auf additive, niemals
einschränkende Weise. Eine koordinierte Kraftanstrengung auf höchster
Systemebene soll zu diesem Zweck umfängliche Finanzierungen und technische
Entwicklungen mobilisieren. Der Glaube an diese Green-Growth-Logik mag zwar
inzwischen erodieren, nicht aber die naiv-modernistische Steuerungsillusion, der
zufolge Regierungsinstanzen und andere kollektive Akteure (zum Beispiel Gewerk-
schaften, Kirchen, NGOs) über ein universelles Instrumentarium verfügen, das in
den Dienst auch jeder anderen Transformationsrichtung gestellt werden könnte.
Tatsächlich war aber jede bis dato erwogene oder umgesetzte Nachhaltigkeits- und
Sozialpolitik an Wachstumsprozesse gekoppelt, stand also unter dem Vorbehalt,
für niemanden mit Wohlstandsverlusten einherzugehen. Mit dieser staatlichen
Garantie ließen sich Wahlen und folglich politische Handlungsspielräume gewinnen
– aber eben nur solche, die auf unerfüllbaren Green-(New)-Deal-Versprechen
beruhten. Nun, da dieser Deal auffliegt, weil die erforderlichen grünen
Wohlstandssubstitute nie existierten oder sich als nicht minder ruinös heraus-
stellen, steht der Kaiser nackt da. Ihm bliebe nur die Option, Einschränkungen zu
oktroyieren, die allem widersprechen, womit sich Regierungen seit dem Zweiten
Weltkrieg legitimiert und erfolgreich angebiedert haben. Eine konsequente
Degrowth- oder Postwachstumsstrategie käme deshalb unter den momentanen
kulturellen Bedingungen einem politischen Selbstmord gleich. Deshalb
verschanzen sich demokratische Regierungen hinter technologischen
Nachhaltigkeitsattrappen, die erstens politische Handlungsfähigkeit simulieren,
zweitens den Wohlstand unangetastet lassen, drittens das Gewissen beruhigen
und viertens eine profitable »grüne« Industrie entstehen lassen.
Fazit: Was die Wählergunst sichert, endet langfristig im ökologischen Abgrund.
Und was die Lebensgrundlagen sichert, endet kurzfristig im politischen Abgrund.
Angesichts dieses Dilemmas müsste auf die Wachstumswende eine Politikwende
folgen. Diese kann nur auf einer doppelten Umkehrung gründen, nämlich erstens
die Nachhaltigkeitspraxis, zweitens den sozialen und institutionellen Hintergrund
eines gesellschaftlichen Wandels betreffend.
Quelle: https://taz.de/Debatte-Wirtschaft-und-Wachstum/!5932364/



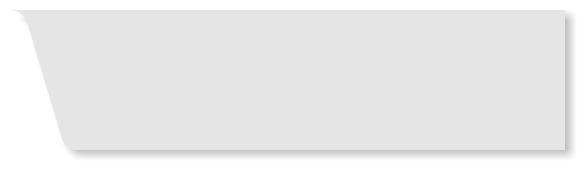
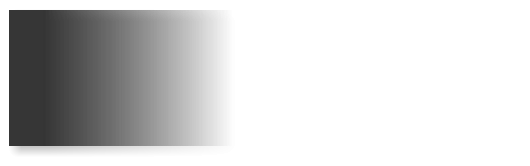

Debatte Wirtschaft und Wachstum:
Der grüne Osterhase
Es gibt keine Entkopplung von
Wachstum und planetarischer
Zerstörung, weshalb es auch keine
politische Umsteuerung geben kann.
Aber es gibt Rettungsboote.
Ökonomische Transformation: Grünes Wachstum
oder Degrowth? Foto: Archiv
Von NIKO PAECH
In einem Beitrag in der
vorhergehenden Ausgabe von taz
FUTURZWEI (Nr. 23) referiert der
Politologe Martin Unfried aktuelle
Vorschläge zur klimagerechten
Transformation moderner Ökonomien.
Beginnend mit der Position des grünen
Wachstums legt er deren Vertretern
nahe, sie mögen »die Schwachstellen
des eigenen Ansatzes offen benennen
und mögliche Lösungen diskutieren«.
Zu Recht verweist er dabei auf die
misslingende Entkopplung wachsenden
Wohlstandes von Umweltschäden.
Aber insoweit grünes Wachstum in
nichts anderem besteht als eben darin,
steigende Güterproduktion ökologisch
zu entkoppeln, strandet diese
Empfehlung in einem Zirkelschluss.
Denn ebenso ließe sich dann die
Nichtexistenz des Osterhasen als
dessen Schwachstelle identifizieren,
für die Lösungen zu suchen wären.
Das Problem des grünen Wachstums
liegt also eher in der Fortschritts-
gläubigkeit jener, die an dieser allen
Naturgesetzen widersprechenden
Absurdität weiter festhalten.
Sodann werden einige wachstums-
kritische Veröffentlichungen ins Visier
genommen. Ihnen fehle es an
konkreten Umsetzungsperspektiven,
insbesondere einer »ausgearbeiteten
Makroökonomie«, um ein »stabiles
Nicht-Wachsen« steuern zu können.
Offensichtlich übersieht Martin Unfried,
dass längst makroökonomische
Modelle vorliegen, die eine Degrowth-
Strategie als stabilen Entwicklungspfad
darstellen. Das Problem bestand nie
darin, Postwachstumsszenarien
herauszuarbeiten, die sich in politische
Maßnahmen überführen lassen,
sondern in den unvermeidbaren Folgen
für den vorherrschenden Lebensstil.
Denn auch mit einer ausgeklügelten
Makroökonomik lässt sich weder die
Physik noch die Wählermehrheit
überlisten. Ohne die Letztere ist eine
zentral koordinierte Degrowth-
Strategie aber nicht demokratisch zu
rechtfertigen. Wenn kein
technologisches Entkopplungswunder
zu erwarten ist, folgt daraus neben der
Notwendigkeit einer
Postwachstumsökonomie eine zweite,
nicht minder einschneidende
Konsequenz: Demokratische
Regierungen verlieren im
Nachhaltigkeitsbereich die Basis ihrer
bisherigen Handlungsfähigkeit.
Die Imagination einer vernunft-
geleiteten Wählermehrheit, die sich
rechtzeitig herausbildet, um für das
politisch Notwendige zu votieren,
stützt sich auf die verführerische
Annahme, dass Umweltprobleme durch
kollektive Entscheidungen komfortabel
und effizient gelöst werden können,
nämlich auf additive, niemals
einschränkende Weise. Eine
koordinierte Kraftanstrengung auf
höchster Systemebene soll zu diesem
Zweck umfängliche Finanzierungen
und technische Entwicklungen
mobilisieren. Der Glaube an diese
Green-Growth-Logik mag zwar
inzwischen erodieren, nicht aber die
naiv-modernistische Steuerungs-
illusion, der zufolge Regierungs-
instanzen und andere kollektive
Akteure (zum Beispiel Gewerk-
schaften, Kirchen, NGOs) über ein
universelles Instrumentarium
verfügen, das in den Dienst auch jeder
anderen Transformationsrichtung
gestellt werden könnte.
Tatsächlich war aber jede bis dato
erwogene oder umgesetzte
Nachhaltigkeits- und Sozialpolitik an
Wachstumsprozesse gekoppelt, stand
also unter dem Vorbehalt, für
niemanden mit Wohlstandsverlusten
einherzugehen. Mit dieser staatlichen
Garantie ließen sich Wahlen und
folglich politische Handlungsspielräume
gewinnen – aber eben nur solche, die
auf unerfüllbaren Green-(New)-Deal-
Versprechen beruhten. Nun, da dieser
Deal auffliegt, weil die erforderlichen
grünen Wohlstandssubstitute nie
existierten oder sich als nicht minder
ruinös herausstellen, steht der Kaiser
nackt da. Ihm bliebe nur die Option,
Einschränkungen zu oktroyieren, die
allem widersprechen, womit sich
Regierungen seit dem Zweiten
Weltkrieg legitimiert und erfolgreich
angebiedert haben. Eine konsequente
Degrowth- oder Postwachstums-
strategie käme deshalb unter den
momentanen kulturellen Bedingungen
einem politischen Selbstmord gleich.
Deshalb verschanzen sich
demokratische Regierungen hinter
technologischen Nachhaltigkeits-
attrappen, die erstens politische
Handlungsfähigkeit simulieren,
zweitens den Wohlstand unangetastet
lassen, drittens das Gewissen
beruhigen und viertens eine profitable
»grüne« Industrie entstehen lassen.
Fazit: Was die Wählergunst sichert,
endet langfristig im ökologischen
Abgrund. Und was die Lebens-
grundlagen sichert, endet kurzfristig
im politischen Abgrund. Angesichts
dieses Dilemmas müsste auf die
Wachstumswende eine Politikwende
folgen. Diese kann nur auf einer
doppelten Umkehrung gründen,
nämlich erstens die Nachhaltigkeits-
praxis, zweitens den sozialen und
institutionellen Hintergrund eines
gesellschaftlichen Wandels betreffend.
Quelle: https://taz.de/Debatte-Wirtschaft-und-
Wachstum/!5932364/























