
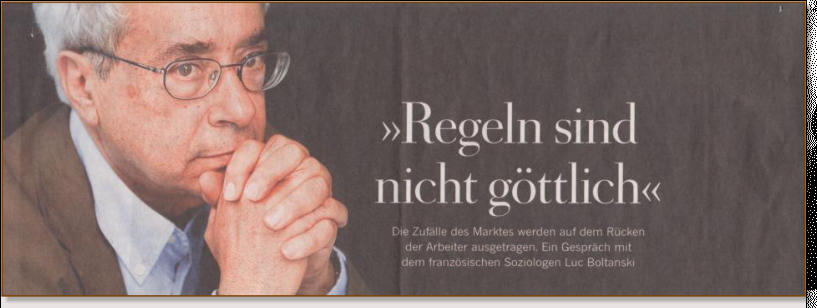
Die ZEIT: Herr Boltanski, in Ihrem neuen
Buch beschreiben Sie die heutige Politik
der pausenlosen Veränderung, des unausg-
esetzten Umbaus. Für Sie ist diese perma-
nente Revolution von Oben eine Form der
Herrschaft. Erstaunlicherweise nennen Sie
in Ihrem Buch nicht die Person, die diese
Herrschaftsform verkörpert, nämlich
Nicolas Sarkozy.
LUC BOLTANSKI: Das muss ich auch
nicht. Es ist jedem Leser klar. Ich schreibe
über das Thema »Wofür steht der Name
Sarkozy?«, um einen Buchtitel des Philo-
sophen Alain Badiou zu zitieren. Allerdings
wurde dieses Etwas schon unter Giscard
d'Estaing geboren.
ZEIT: Sie meinen die Idee der Unaus-
weichlichkeit andauernder Reformen.
BOLTANSKI: Und die Idee, dass Wille und
Notwendigkeit in eins fallen müssen.
ZEIT: Ein historischer Materialismus a la
Thatcher.
BOLTANSKI: Oder ein Hegel, der unter die
Liberalen gefallen ist und sagt: »Es gibt
keine Alternative.« Und jeder Widerstand
dagegen gilt als zwecklos und reaktionär.
Das ging einher, schon unter Giscard, mit
einer zweiten Entwicklung: mit dem
Wachstum der Kompetenz unserer
Mächtigen. Sie verfügen über die Leit-
wissenschaft des späten 20. und des frühen
21. Jahrhunderts, die Wissenschaft vom
Management. Unsere Linke irrt sehr, wenn
sie vom Rückzug des Staates spricht; lesen
Sie nur Le Monde diplomatique: Da
herrscht immer noch die Rollenverteilung
zwischen dem bösen Neoliberalismus und
dem guten Staat, der so schwach geworden
sei. Stattdessen haben wir seit 40 Jahren
noch nie so viel Staat wie heutzutage
gehabt! Nur ist es eben ein anderer Staat;
er wird geführt wie ein Unternehmen, das
unablässig umgebaut wird.
ZEIT: Damit alles beim Alten bleibt?
BOLTANSKI: Ja, aber was ist das, was
bleibt? Ich arbeite gerade an einer Kritik
der Verschwörungstheorien. Denn das
muss aufgeklärt werden: Gibt es überhaupt
eine herrschende Klasse, oder gibt es
wenigstens Netze, haben sie Knoten, oder
ist das alles nur im Fluss? Es gibt zurzeit
keine wirklich stabilen Begriffe davon, wie
Herrschaft, Kapitalismus und Staat
funktionieren. Nur eins ist gewiss: Alle
Beherrschten werden gezwungen, die
permanente Veränderung mitzumachen.
ZEIT: Das tut oft weh.
BOLTANSKI: Eine meiner Studentinnen
hat ein Vierteljahr bei France Telecom
gearbeitet und mir gesagt: Wäre ich
geblieben, hätte ich mich umgebracht. Das
war, bevor von den Selbstmorden in der
Firma gesprochen wurde.
ZEIT: Karl Marx schrieb, dass die Despotie
im Betrieb und Anarchie im Markt
einander bedingen.
BOLTANSKI: Die Frage lautet: Auf wem
lasten die Zufälle des Marktes? Die Antwort
von heute: auf den Arbeitern.
ZEIT: Und das ist eine Form von Herr-
schaft. Sie untersuchen Formen der
Herrschaft, und Sie sagen, dass gesell-
schaftliche Herrschaft sich zwar auf
Normen stützt, die Herrschenden aber über
sie hinweggehen.
BOLTANSKI: Die Beherrschten und
die Herrschenden haben ein
unterschiedliches Verhältnis zu den Regeln.
Ein Herrschender weiß, dass die Regeln
konstruiert sind, denn er ist Teil jener Welt,
in der diese gemacht werden. Er kann die
Regeln interpretieren, flexibel mit ihnen
umgehen, er kann ihren Geist wahren,
indem er sie nicht buchstabengetreu befolgt
und so weiter. Sie kennen das bestimmt aus
Ihren Interviews.
ZEIT: Wie meinen Sie das?
BOLTANSKI: Wenn Sie mit Verantwort-
lichen sprechen, haben Sie dann noch nie
gehört »Das war am Rande des Erlaubten«
oder »Wenn ich mich wortgetreu an die
Regeln gehalten hätte, dann hätte ich das
nie geschafft«?
ZEIT: Ja, da schwingt sogar Stolz mit.
BOLTANSKI: Aber gewiss! Auf den Mut,
auf das Unbotmäßige. Wohingegen die
Beherrschten daran erkannt werden, dass
sie die Regeln bis aufs Wort befolgen
müssen. In Wahrheit tut freilich niemand
exakt das Vorgeschriebene.
ZEIT: Hätten Sie ein Beispiel?
BOLTANSKI: Viele! Etwa aus der
Arbeitssoziologie. In der modernen Fabrik,
die just in time produziert und liefert, darf
beispielsweise niemand irgendwelche Lager
haben, um sich ein wenig Spielraum zu
schaffen. Aber wir haben in unseren Unter-
suchungen herausgefunden, dass das
Management sehr wohl Ausnahmen zu
finden weiß, sich das Leben zu erleichtern.
Und die Arbeiter auch! Nur dass diese das
heimlich tun, und wenn ein Manager
vorbeikommt, werden die aufgesparten
Teile schnell auf einem Lastwagen ver-
steckt. So, und die Idee meines neuen
Buches ist eben die, dass über solche Über-
schreitungen offen gesprochen werden
sollte. Dass Regeln und Institutionen eben
Arrangements und nicht göttlich sind.
ZEIT: Ihr neues Buch heißt »Soziologie und
Sozialkritik«. Worin besteht die gesell-
schaftliche Rolle der Kritik?
BOLTANSKI: Der Ausgangspunkt des
Buches ist, dass die Gesellschaft Institu-
tionen braucht. Nicht weil sonst jeder
gegen jeden kämpfen würde. Ich bin da
nicht so pessimistisch wie die traditionelle
politische Theorie. Aber weil jeder wissen
muss, woran er ist. Wenn Sie zum Beispiel
einen Artikel schreiben wollen, aber Ihre
Kinder toben herum, wollen fernsehen,
Zimmerfußball spielen oder Rockmusik
hören, dann müssen Sie die Situation, die
Beteiligten und ihre Interessen definieren,
ihnen jeweils eine bestimmte Qualität
zumessen. Sie entscheiden darüber, was
jetzt wichtig ist.
ZEIT: In der Gesellschaft ist das genauso?
BOLTANSKI: Das Problem ist, dass in
der Gesellschaft kein menschliches
Wesen auf Dauer diese Autorität haben
kann. Jeder Mensch hat einen Körper,
steht in Zeit und Raum und auf seinem
Standpunkt. Wie soll er da eine über-
individuelle Autorität haben?
Andererseits können wir nicht in einer
Welt leben, in der es keine stabilen
Bestimmungen dessen gibt, was als real
gilt. Also brauchen wir ein Wesen ohne
Körper, ein im körperlichen Sinn nicht
existentes Wesen.
ZEIT: Die Götter.
BOLTANSKI: Oder den Staat.
Institutionen eben. Sie geben an, was als
Realität gelten soll. Sie unterscheiden
zwischen Lärm und Musik, oder
zwischen dem, was gut für Europa ist
und was nicht. Das Problem ist nur:
Körperlose Wesen können nicht
sprechen. Sie brauchen Sprecher. Die
unterscheiden sich schon äußerlich von
anderen Menschen, etwa durch die
Uniform, durch Abzeichen und Anzüge.
Freilich kann man immer Zweifel hegen,
wer da gerade spricht: Ist es die
Institution? Ist es doch nur das
Individuum?
ZEIT: Ist das die Aufgabe der Kritik?
BOLTANSKI: Eine ihrer Aufgaben. Eine
gute Gesellschaft ist diejenige, in der
zwar Institutionen existieren, sodass
nicht ohne Unterlass alles und jedes neu
verabredet werden muss, aber in der
diese Institutionen zugleich und
pausenlos kritisiert werden können. Ein
Universum, in dem nur die Institu-
tionen das Wort fuhren, wäre
eindimensional.
ZEIT: Und bewegungslos.
BOLTANSKI: Weswegen es das in
Reinform auch nicht geben kann. Ich
diskutiere darüber viel mit meinen
Kollegen von der Anthropologie und
behaupte: In jeder Gesellschaft gibt es
Kritik, mal mehr, mal weniger, aber
eindimensional ist keine.
ZEIT: Wie weit gehen Sie, wenn Sie
sagen, Institutionen sind letztlich sozial
konstruierte Fiktionen?
BOLTANSKI: Man spricht ja gern
davon, dass alles Mögliche nur soziale
Konstruktion sei. Aber für die Gesell-
schaft ist es nötig, dass diese Konstruk-
tionen fixiert werden, man könnte
sagen: essentialisiert, sodass sie also
eine Essenz werden, auf die man sich
verlassen kann.
ZEIT: Ein Beispiel?
BOLTANSKI: Wenn jemand sagt: »Das
hier ist ja kein echtes Seminar«, dann
gibt es eine Vorstellung davon, was ein
echtes Seminar ist.
ZEIT: Eine Wahrheit.
BOLTANSKI: Aber nicht eine, die vom
Himmel gefallen ist. Sie muss jederzeit
kritisiert werden können.
ZEIT: Und ist selbst ein Werkzeug der
Kritik.
BOLTANSKI: In dem neuen Buch
unterscheide ich mehrere Formen der
Kritik. Die reformistische Kritik zeigt
beispielsweise, dass die Wirklichkeit
nicht der Selbstbeschreibung der
Institutionen entspricht. Zum Beispiel:
»Man hat die Wahl gefälscht.« Diese
Kritik prangert etwas an, geht aber auch
mit etwas Bestehendem konform,
nämlich mit dem Prinzip fairer Wahlen.
Sie bestärkt die bestehende Ordnung.
ZEIT: Und die radikale Kritik?
BOLTANSKI: Ihr Ausgangspunkt ist das
existenzielle Erleben. Sie bringt es zur
Sprache, sie bringt es in die Realität.
Wobei ich glaube, dass das vor allem in
der Kunst möglich ist.
ZEIT: Sie dichten und schreiben
Theaterstücke.
BOLTANSKI: Ich muss dort nicht den
Zwängen des Argumentierens folgen.
Das Schöne am Theater ist, dass Sie das
Gegenteil dessen sagen können, was Sie
denken. Sie müssen das Gesagte nicht
rechtfertigen.
ZEIT: In der Literatur ist die Kritik also
freier als außerhalb?
BOLTANSKI: Ja, sie ist anderswo sehr
strengen Regeln unterworfen. Sie wird
normalisiert. Nehmen Sie zum Beispiel
Leserbriefe, in denen sich Menschen
über Ungerechtigkeiten beschweren; ich
habe das einmal untersucht. Da wird
unterschieden, welche Beschwerde
seriös ist und welche offenbar von einem
Verrückten stammt. Also müssen Sie Ihr
Anliegen so formulieren, dass Sie keiner
für verrückt halten könnte. Eine Grenze
der Kritik.
ZEIT: Was wäre das Projekt, das sich
gegen Verhältnisse von Abhängigkeit
und Unterdrückung in Stellung bringen
ließe?
BOLTANSKI: Projekte entstehen erst in
den Revolten.
ZEIT: Nicht vorher?
BOLTANSKI: Nur in wenigen Köpfen.
Aber die Geschichte der Französischen
Revolution und später der Arbeiter-
bewegung zeigt, dass es der Empörung
bedarf, damit neue Ideen entstehen. Sie
finden diesen Gedanken letztlich schon
bei Friedrich Schiller und natürlich bei
Karl Marx. Die Entfremdung ist so groß,
dass man noch nicht einmal weiß, was
das Gute ist. Nur das Böse ist allzu sehr
bekannt. Nein, man fängt stets erst mit
dem an, was man nicht will. In der
Negativität.
ZEIT: Es gibt vieles, was Sie von dem
Philosophen Alain Badiou trennt...
BOLTANSKI: Alles!
ZEIT: ... nur eben das nicht.
BOLTANSKI: Und wissen Sie auch,
warum? Weil er von Jean-Paul Sartre
kommt, der uns gelehrt hat, dass das
Positive aus der Negativität entsteht.
DAS GESPRÄCH FÜHRTE GERO VON
RANDOW
DIE ZEIT, Juli 2010
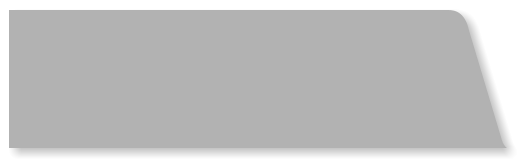

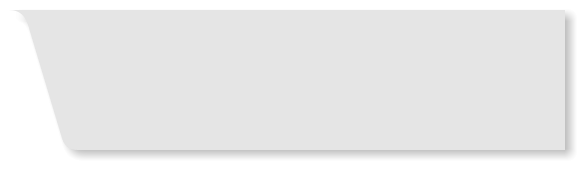
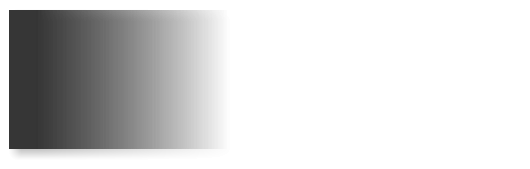
Siegfried
Trapp
Willkommen
Bienvenido
Welcome
© strapp 2011


Die ZEIT: Herr Boltanski, in Ihrem neuen
Buch beschreiben Sie die heutige Politik
der pausenlosen Veränderung, des unausg-
esetzten Umbaus. Für Sie ist diese perma-
nente Revolution von Oben eine Form der
Herrschaft. Erstaunlicherweise nennen Sie
in Ihrem Buch nicht die Person, die diese
Herrschaftsform verkörpert, nämlich
Nicolas Sarkozy.
LUC BOLTANSKI: Das muss ich auch
nicht. Es ist jedem Leser klar. Ich schreibe
über das Thema »Wofür steht der Name
Sarkozy?«, um einen Buchtitel des Philo-
sophen Alain Badiou zu zitieren. Allerdings
wurde dieses Etwas schon unter Giscard
d'Estaing geboren.
ZEIT: Sie meinen die Idee der Unaus-
weichlichkeit andauernder Reformen.
BOLTANSKI: Und die Idee, dass Wille und
Notwendigkeit in eins fallen müssen.
ZEIT: Ein historischer Materialismus a la
Thatcher.
BOLTANSKI: Oder ein Hegel, der unter die
Liberalen gefallen ist und sagt: »Es gibt
keine Alternative.« Und jeder Widerstand
dagegen gilt als zwecklos und reaktionär.
Das ging einher, schon unter Giscard, mit
einer zweiten Entwicklung: mit dem
Wachstum der Kompetenz unserer
Mächtigen. Sie verfügen über die Leit-
wissenschaft des späten 20. und des frühen
21. Jahrhunderts, die Wissenschaft vom
Management. Unsere Linke irrt sehr, wenn
sie vom Rückzug des Staates spricht; lesen
Sie nur Le Monde diplomatique: Da
herrscht immer noch die Rollenverteilung
zwischen dem bösen Neoliberalismus und
dem guten Staat, der so schwach geworden
sei. Stattdessen haben wir seit 40 Jahren
noch nie so viel Staat wie heutzutage
gehabt! Nur ist es eben ein anderer Staat;
er wird geführt wie ein Unternehmen, das
unablässig umgebaut wird.
ZEIT: Damit alles beim Alten bleibt?
BOLTANSKI: Ja, aber was ist das, was
bleibt? Ich arbeite gerade an einer Kritik
der Verschwörungstheorien. Denn das
muss aufgeklärt werden: Gibt es überhaupt
eine herrschende Klasse, oder gibt es
wenigstens Netze, haben sie Knoten, oder
ist das alles nur im Fluss? Es gibt zurzeit
keine wirklich stabilen Begriffe davon, wie
Herrschaft, Kapitalismus und Staat
funktionieren. Nur eins ist gewiss: Alle
Beherrschten werden gezwungen, die
permanente Veränderung mitzumachen.
ZEIT: Das tut oft weh.
BOLTANSKI: Eine meiner Studentinnen
hat ein Vierteljahr bei France Telecom
gearbeitet und mir gesagt: Wäre ich
geblieben, hätte ich mich umgebracht. Das
war, bevor von den Selbstmorden in der
Firma gesprochen wurde.
ZEIT: Karl Marx schrieb, dass die Despotie
im Betrieb und Anarchie im Markt
einander bedingen.
BOLTANSKI: Die Frage lautet: Auf wem
lasten die Zufälle des Marktes? Die Antwort
von heute: auf den Arbeitern.
ZEIT: Und das ist eine Form von Herr-
schaft. Sie untersuchen Formen der
Herrschaft, und Sie sagen, dass gesell-
schaftliche Herrschaft sich zwar auf
Normen stützt, die Herrschenden aber über
sie hinweggehen.
BOLTANSKI: Die Beherrschten und die
Herrschenden haben ein unterschiedliches
Verhältnis zu den Regeln. Ein
Herrschender weiß, dass die Regeln
konstruiert sind, denn er ist Teil jener Welt,
in der diese gemacht werden. Er kann die
Regeln interpretieren, flexibel mit ihnen
umgehen, er kann ihren Geist wahren,
indem er sie nicht buchstabengetreu befolgt
und so weiter. Sie kennen das bestimmt aus
Ihren Interviews.
ZEIT: Wie meinen Sie das?
BOLTANSKI: Wenn Sie mit Verantwort-
lichen sprechen, haben Sie dann noch nie
gehört »Das war am Rande des Erlaubten«
oder »Wenn ich mich wortgetreu an die
Regeln gehalten hätte, dann hätte ich das
nie geschafft«?
ZEIT: Ja, da schwingt sogar Stolz mit.
BOLTANSKI: Aber gewiss! Auf den Mut,
auf das Unbotmäßige. Wohingegen die
Beherrschten daran erkannt werden, dass
sie die Regeln bis aufs Wort befolgen
müssen. In Wahrheit tut freilich niemand
exakt das Vorgeschriebene.
ZEIT: Hätten Sie ein Beispiel?
BOLTANSKI: Viele! Etwa aus der
Arbeitssoziologie. In der modernen Fabrik,
die just in time produziert und liefert, darf
beispielsweise niemand irgendwelche Lager
haben, um sich ein wenig Spielraum zu
schaffen. Aber wir haben in unseren Unter-
suchungen herausgefunden, dass das
Management sehr wohl Ausnahmen zu
finden weiß, sich das Leben zu erleichtern.
Und die Arbeiter auch! Nur dass diese das
heimlich tun, und wenn ein Manager
vorbeikommt, werden die aufgesparten
Teile schnell auf einem Lastwagen ver-
steckt. So, und die Idee meines neuen
Buches ist eben die, dass über solche Über-
schreitungen offen gesprochen werden
sollte. Dass Regeln und Institutionen eben
Arrangements und nicht göttlich sind.
ZEIT: Ihr neues Buch heißt »Soziologie und
Sozialkritik«. Worin besteht die gesell-
schaftliche Rolle der Kritik?
BOLTANSKI: Der Ausgangspunkt des
Buches ist, dass die Gesellschaft Institu-
tionen braucht. Nicht weil sonst jeder
gegen jeden kämpfen würde. Ich bin da
nicht so pessimistisch wie die traditionelle
politische Theorie. Aber weil jeder wissen
muss, woran er ist. Wenn Sie zum Beispiel
einen Artikel schreiben wollen, aber Ihre
Kinder toben herum, wollen fernsehen,
Zimmerfußball spielen oder Rockmusik
hören, dann müssen Sie die Situation, die
Beteiligten und ihre Interessen definieren,
ihnen jeweils eine bestimmte Qualität
zumessen. Sie entscheiden darüber, was
jetzt wichtig ist.
ZEIT: In der Gesellschaft ist das genauso?
BOLTANSKI: Das Problem ist, dass in der
Gesellschaft kein menschliches Wesen auf
Dauer diese Autorität haben kann. Jeder
Mensch hat einen Körper, steht in Zeit und
Raum und auf seinem Standpunkt. Wie soll
er da eine über-individuelle Autorität
haben? Andererseits können wir nicht in
einer Welt leben, in der es keine stabilen
Bestimmungen dessen gibt, was als real
gilt. Also brauchen wir ein Wesen ohne
Körper, ein im körperlichen Sinn nicht
existentes Wesen.
ZEIT: Die Götter.
BOLTANSKI: Oder den Staat. Institutionen
eben. Sie geben an, was als Realität gelten
soll. Sie unterscheiden zwischen Lärm und
Musik, oder zwischen dem, was gut für
Europa ist und was nicht. Das Problem ist
nur: Körperlose Wesen können nicht
sprechen. Sie brauchen Sprecher. Die
unterscheiden sich schon äußerlich von
anderen Menschen, etwa durch die
Uniform, durch Abzeichen und Anzüge.
Freilich kann man immer Zweifel hegen,
wer da gerade spricht: Ist es die
Institution? Ist es doch nur das
Individuum?
ZEIT: Ist das die Aufgabe der Kritik?
BOLTANSKI: Eine ihrer Aufgaben. Eine
gute Gesellschaft ist diejenige, in der zwar
Institutionen existieren, sodass nicht ohne
Unterlass alles und jedes neu verabredet
werden muss, aber in der diese
Institutionen zugleich und pausenlos
kritisiert werden können. Ein Universum,
in dem nur die Institu-tionen das Wort
fuhren, wäre eindimensional.
ZEIT: Und bewegungslos.
BOLTANSKI: Weswegen es das in
Reinform auch nicht geben kann. Ich
diskutiere darüber viel mit meinen
Kollegen von der Anthropologie und
behaupte: In jeder Gesellschaft gibt es
Kritik, mal mehr, mal weniger, aber
eindimensional ist keine.
ZEIT: Wie weit gehen Sie, wenn Sie sagen,
Institutionen sind letztlich sozial
konstruierte Fiktionen?
BOLTANSKI: Man spricht ja gern davon,
dass alles Mögliche nur soziale
Konstruktion sei. Aber für die Gesell-schaft
ist es nötig, dass diese Konstruk-tionen
fixiert werden, man könnte sagen:
essentialisiert, sodass sie also eine Essenz
werden, auf die man sich verlassen kann.
ZEIT: Ein Beispiel?
BOLTANSKI: Wenn jemand sagt: »Das hier
ist ja kein echtes Seminar«, dann gibt es
eine Vorstellung davon, was ein echtes
Seminar ist.
ZEIT: Eine Wahrheit.
BOLTANSKI: Aber nicht eine, die vom
Himmel gefallen ist. Sie muss jederzeit
kritisiert werden können.
ZEIT: Und ist selbst ein Werkzeug der
Kritik.
BOLTANSKI: In dem neuen Buch
unterscheide ich mehrere Formen der
Kritik. Die reformistische Kritik zeigt
beispielsweise, dass die Wirklichkeit nicht
der Selbstbeschreibung der Institutionen
entspricht. Zum Beispiel: »Man hat die
Wahl gefälscht.« Diese Kritik prangert
etwas an, geht aber auch mit etwas
Bestehendem konform, nämlich mit dem
Prinzip fairer Wahlen. Sie bestärkt die
bestehende Ordnung.
ZEIT: Und die radikale Kritik?
BOLTANSKI: Ihr Ausgangspunkt ist das
existenzielle Erleben. Sie bringt es zur
Sprache, sie bringt es in die Realität. Wobei
ich glaube, dass das vor allem in der Kunst
möglich ist.
ZEIT: Sie dichten und schreiben
Theaterstücke.
BOLTANSKI: Ich muss dort nicht den
Zwängen des Argumentierens folgen. Das
Schöne am Theater ist, dass Sie das
Gegenteil dessen sagen können, was Sie
denken. Sie müssen das Gesagte nicht
rechtfertigen.
ZEIT: In der Literatur ist die Kritik also
freier als außerhalb?
BOLTANSKI: Ja, sie ist anderswo sehr
strengen Regeln unterworfen. Sie wird
normalisiert. Nehmen Sie zum Beispiel
Leserbriefe, in denen sich Menschen über
Ungerechtigkeiten beschweren; ich habe
das einmal untersucht. Da wird
unterschieden, welche Beschwerde seriös
ist und welche offenbar von einem
Verrückten stammt. Also müssen Sie Ihr
Anliegen so formulieren, dass Sie keiner für
verrückt halten könnte. Eine Grenze der
Kritik.
ZEIT: Was wäre das Projekt, das sich
gegen Verhältnisse von Abhängigkeit und
Unterdrückung in Stellung bringen ließe?
BOLTANSKI: Projekte entstehen erst in
den Revolten.
ZEIT: Nicht vorher?
BOLTANSKI: Nur in wenigen Köpfen.
Aber die Geschichte der Französischen
Revolution und später der Arbeiter-
bewegung zeigt, dass es der Empörung
bedarf, damit neue Ideen entstehen. Sie
finden diesen Gedanken letztlich schon bei
Friedrich Schiller und natürlich bei Karl
Marx. Die Entfremdung ist so groß, dass
man noch nicht einmal weiß, was das Gute
ist. Nur das Böse ist allzu sehr bekannt.
Nein, man fängt stets erst mit dem an, was
man nicht will. In der Negativität.
ZEIT: Es gibt vieles, was Sie von dem
Philosophen Alain Badiou trennt...
BOLTANSKI: Alles!
ZEIT: ... nur eben das nicht.
BOLTANSKI: Und wissen Sie auch,
warum? Weil er von Jean-Paul Sartre
kommt, der uns gelehrt hat, dass das
Positive aus der Negativität entsteht.
DAS GESPRÄCH FÜHRTE GERO VON
RANDOW
DIE ZEIT, Juli 2010
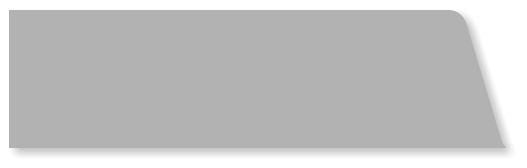

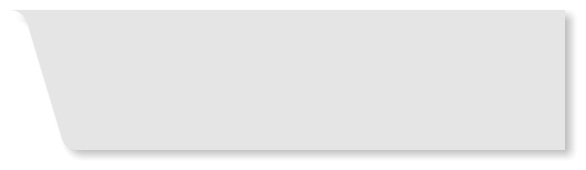

© strapp 2011































